|
|
|
Die nachstehende
Arbeit kam zum Erstabdruck im Jahrbuch Bad Salzuflen 1999.
Dem Autor, Herrn Dr. Nicolas Rügge, und den Herausgebern des
Jahrbuches, den Herren Franz Meyer, Uwe Rottkamp und Stefan
Wiesekopsieker bin ich für die Genehmigung, den Aufsatz in der
Wüstener Geschichts-Hompage „www.woiste.de“ veröffentlichen zu
dürfen, sehr dankbar. Berührt doch das Geschehene nicht nur die
Verhältnisse im Fürstentum Lippe um die Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert sondern auch die Geschichte der beiden Bauerschaften
Ober- und Unterwüsten und im weitesten Sinne auch meine eigene
Familienhistorie. |
|
"Des Leibeigenthums entlassen"
Ein Freikauf aus Wüsten aus dem Jahre 1796 |
|
| Nicolas
Rügge |
|
Auf zahlreichen lippischen Höfen
werden noch Schriftstücke aus vergangenen
Jahrhunderten verwahrt. Was die Vorfahren mit
Bedacht aufhoben, weil es ihre Rechte und Ansprüche
dokumentierte, hat zwar inzwischen meist keine
praktische Bedeutung mehr, ist aber für den
Historiker von hohem Aussagewert. Denn die
erhaltenen Schuldverschreibungen, Eheprotokolle,
Prozeßakten usw. ermöglichen detaillierte Einblicke
in die Sozial- und Familiengeschichte früherer
Zeiten und ergänzen die „offiziellen“, in den
staatlichen und kommunalen Archiven verwahrten
Bestände. |
|
Doch so erfreulich es ist, wenn ein
Hof- und Familienarchiv gepflegt und in Ehren
gehalten wird, es besteht immer die Gefahr, daß die
Überlieferung auf längere Sicht verloren geht. Ein
Hausbrand kommt |
|
|
|
heute zwar viel seltener vor als früher, doch was
zehn Generationen aufgehoben haben, wirft die elfte
möglicherweise achtlos weg. Auch werden die
Dokumente nicht immer sachgerecht gelagert, sondern
mitunter dem Licht oder der Feuchtigkeit zu sehr
ausgesetzt. Im Zweifelsfall ist daher zu erwägen, ob
man sich nicht lieber eine gute Reproduktion an die
Wand hängen und die Originale als Leihgabe einem
Archiv übergeben sollte. Die Eigentumsverhältnisse
ändern sich hierdurch nicht, und die alten „Schätze“
können jederzeit nach Hause zurückgeholt werden. |
|
Auf solche Weise erhielt das Stadtarchiv Bad
Salzuflen im Dezember 1996 eine 200 Jahre alte
Pergament-Urkunde mit (etwas beschädigtem) Siegel.
Der Eigentümer Ewald Becker aus Lemgo-Brüntorf,
machte das Dokument damit dankenswerterweise der
Öffentlichkeit bekannt und zugänglich.1 |
|
|
|
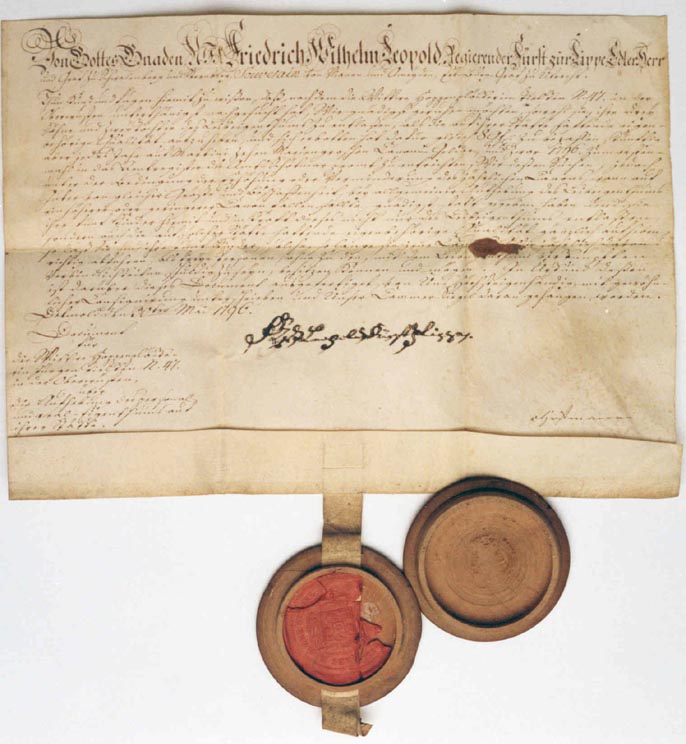 |
|
Die Urkunde
über den Freikauf der Witwe Tielke mit der Unterschrift des
Fürsten Leopold zur Lippe und dem (beschädigten) Siegel der
Fürstlich Lippischen (Rent-)Kammer. |
|
| Der
Text der Urkunde lautet: |
|
Von Gottes Gnaden, Wir Friedrich
Wilhelm Leopold, Regierender Fürst zur Lippe, Edler
Herr und Graf zu Schwalenberg und Sternberg,
Souverain von Vianen und Ameyden, Erb-Burg-Graf zu
Ütrecht. |
|
Thun kund und fügen hiermit zu
wissen, daß, nachdem die Wittwe Hoppenplöckerin
Tielken N[ummer] 47 in der Oberwüsten unterthänigst
nachgesucht hat, Wir gnädigst geruhen möchten,
sowohl sie, ihre drey Söhne und zwey Töchter des
Leibeigenthums zu entlassen, als die auf ihrer
Stätte haftende eigenbehörige Qualität aufzuheben,
und sich erbotten hat dafür gleich 8 Gfl. [=
Goldflorin, Gulden] zu bezahlen, künftig aber jedes
Jahr auf Martini [= 11. November] zehn
Mariengroschen Canons-Gelder, und zwar 1796 zum
erstenmahl in das Rentregister des Amts Schötmar
promt zu entrichten, wir dessen Suchen, jedoch unter
der Bedingung der Erhöhung oder Verminderung des
jährlichen Canons, wann auf Güter von gleicher Größe
und Beschaffenheit, bey allgemeiner Aufhebung des
Leibeigenthums ein |
|
|
|
höherer oder geringerer Canon fallen sollte,
gnädigst statt gegeben haben und sie, ihre fünf
Kinder hiemit und in Kraft dieses [Briefes] nicht
nur des Leibeigenthums entlassen, sondern auch die
auf solcher Stätte haftende eigenbehörige Qualität
gänzlich aufheben, so daß Sie und ihre Kinder
solche, so lange sie jene Canons-Gelder jährlich
davon richtig abführen, als freie Personen, ohne zu
den mit dem Leibeigenthum verknüpften
Verbindlichkeiten schuldig zu seyn, besitzen können
und mögen. Zu Urkund dessen ist darüber dieses
Document ausgefertigt, von Uns Höchsteigenhändig,
mit gewöhnlicher Consignierung unterschrieben und
Unser Cammer-Siegel daran gehangen worden. |
|
Detmold den 30ten Mai 1796. |
[gez.] F W Leopold Fürst z[ur] Lippe.
v. Hoffmann [Kanzler] |
|
Document für die Wittwe Hoppenplöckerin Jürgen
Tielken N[ummer] 47 in der Oberwüsten, über die
Aufhebung des personal- und real-Eigenthums auf
ihrer Stätte. |
|
|
|
Um nun die Art der hier vorgenommenen
„Befreiung“ besser verstehen zu können, sei kurz an
die grundherrschaftliche Verfassung der lippischen
Dörfer erinnert. Die damals als „Colonate“
bezeichneten ländlichen Anwesen, wurden von den
Bewohnern fast ausnahmslos nur „meierstättisch“
besessen, was bedeutete, daß die wirtschaftenden
Familien streng genommen nicht über Eigentumsrechte
an Grund und Boden verfügten. Auch wenn sie in der
Regel über eine viele Generationen ungestört im
Besitz der Höfe blieben, waren sie rechtlich gesehen
nur Erbpächter, die ohne Zustimmung des Grundherren
keine Verpfändungen oder gar Veräußerungen vornehmen
durften. |
|
Die Witwe Tielke stand als „Hoppenplöckerin“
auf der zweituntersten Stufe der, je nach
Steuerkraft, in verschiedene Besitzklassen
eingestuften Colonate. Der kleine Hof war eine
typische Spätsiedlerstelle, deren Gründung erst in
eine Zeit fiel, als das beste Ackerland längst an
die größeren Höfe vergeben war. Der Stättegründer
Jürgen Tielke stammte vermutlich von dem Hof Nr. 11
in Unterwüsten (heute Pehlen Nr. 2). 1669 erhielt er
vom Landesherrn ein kleines, zusammenhängendes
Landstück in Oberwüsten angewiesen und baute dort
ein Haus. Durch diese Ansiedlung auf einem zuvor als
Hude oder Wald genutzten Gelände, das dem lippischen
Grafen gehörte („Zuschlag“), wurde Tielke, anders
als seine Vorfahren, dem Landesherrn „eigenbehörig“
(leibeigen). Zur Unterscheidung von den anderen
Wüstener Familien dieses Namens wurde die Stätte,
wie in der Urkunde zu lesen, nach dem Erstsiedler
mitunter als „Jürgen-Tielke“ bezeichnet. |
|
Der Ertrag der Stätte war gering, und
die Bewohner mußten sich zweifellos im
Leinengewerbe, als Arbeitskräfte auf den großen
Höfen oder als Wanderarbeiter einen zusätzlichen
Erwerb verschaffen. Selbst nach vermutlichen
Neuerwerbungen im Zuge der Gemeinheitsteilungen
gehörten nur 3,75 ha Land zu der Stätte (1883). Von
der Familie Tielke ging der Hof um 1900 an die
Eheleute Becker in Brüntorf über, von deren
Nachfahren Ewald Becker das Stadtarchiv die Urkunde
erhielt. An die Tielkes erinnern noch zwei Häuser
von 1813 und 1882 mit Torbogeninschriften (Voßhäger
Weg 5/5a).2 |
|
Wie in der textlichen Zusammenfassung
der Urkunde betont wird, wurde die Familie Tielke in
doppelter Weise „befreit“. Zum einen ging es um das
„Leibeigentum“3 im engeren Sinn: Von den
persönlich Unfreien stand dem Leibherrn (hier: dem
lippischen Grafen) der „Sterbefall“ zu, eine Art von
Erbschaftssteuer, die die „Leibfreien“ unter den
lippischen Bauern nicht zu entrichten brauchten.
Außerdem waren die „Eigenbehörigen“ in ihrer
Freizügigkeit eingeschränkt: Wollten sie fortziehen
oder auf einen freien oder fremden Herren
zugehörigen Hof heiraten, mußten sie sich zuvor bei
ihrem Leibherrn freikaufen. Freibriefe solcher Art
wurden häufig ausgestellt. |
|
Zum anderen handelte es sich in
diesem Fall um den dauerhaften Freikauf der
gesamten Stätte von den leibherrlichen Lasten.
Zugleich fiel fortan auch eine |
|
 |
|
Modernisiertes Deelentor am Haus Voßhäger Weg 5a in
Bad Salzuflen, Ortsteil Wüsten (ehemals Oberwüsten
Nr. 47). Die Torbogeninschrift erinnert an die einst
hier lebende Familie Tielke. |
|
Der
ungelenk formulierte Text lautet:
ANNO 1813 DEN 5 JULIUS HAT JOHANN HENRICH TIELCKE
UND ANNA MARIA FRIEDERIKE KORTMEIERS HABEN DIESES
HAUS LASSEN BAUEN BIS HIERHER HAT MICH DER
HERR GEHOLFEN |
|
|
| wichtige
grundherrliche Abgabe fort, nämlich der bisher beim
Hofantritt zu zahlende Weinkauf. Dies scheint sich
jedenfalls hinter der Aufhebung des „real-Eigenthums“
zu verbergen. Die flächendeckende Umwandlung dieser
Abgaben in feste, ablösbare Renten war schon in der
Regierungszeit des reformfreundlichen Grafen Simon
August (1747-1782) geplant gewesen.4 Der
zitierte Urkundentext von 1796 zeigt, daß man damals
ein solches Gesetz in absehbarer Zeit erwartete und
für die zukünftigen Regelungen „bey allgemeiner
Aufhebung des Leibeigenthums“ Vorsorge trug.5
|
|
Was die Witwe Tielke für sich und ihre Kinder
erlangte, wurde für die anderen dem lippischen
Fürsten eigenen Familien erst 1808 Wirklichkeit. Die
große Ablösung der grundherrlichen Hauptlast,
nämlich der Abgaben und Dienste, setzte erst 1838
ein.6
|
|
Warum den Tielkes schon 1796 an einer Freilassung
gelegen war, lässt sich aus ihren etwas verwickelten
Familien- und Verwandschaftsverhältnissen
erschließen.7 Die 1796 als Witwe Tielke
bezeichnete Frau war zu dieser Zeit 46 Jahre alt.
Sie war geboren am 25. Februar 1750 als Margarete
Ilsabein, Tochter des Friedrich Johann Henrich Pauk
oder Buschmeier in Unterwüsten Nr. 31 (heute
Salzeweg 12). Dieser kleine Hof, ebenfalls eine
Hoppenplöckerstätte, wurde analog zum „Jürgen-Tielke“
auch als „Bernd-Pauk“ bezeichnet. Margarete
Ilsabeins Mutter hatte das Anwesen geerbt; ihr Vater
war aus dem Krautkrug gebürtig und hatte den
Hofnamen angenommen. Am 3. Juni 1771 fand die Heirat
mit dem kinderlos verwitweten Johann Töns Tielke in
Oberwüsten Nr. 47 statt. Sie zog zu ihm auf die
Stätte, wo dem Ehepaar fünf Kinder geboren wurden:
Johann Henrich (1772), Anna Elisabeth (1775), Johann
Bernd (1778), Philipp Henrich (1778) und Johann
Friedrich (1783). |
|
Am 14. März 1784 starb Frau Tielkes Vater, der
Witwer F.J.H. Pauk oder Buschmeier, nach längerer
Krankheit im 58. Lebensjahr. Auf dem Totenbett hatte
er ihr als einzigem überlebendem Kind seine Stätte
und all sein Hab und Gut vermacht. Der eigentliche
Anerbe Johann Albert war einst ohne Erlaubnis aus
dem Land gegangen und soll 1778 als preußischer
Soldat im bayerischen Erbfolgekrieg in Sachsen
gestorben sein. Da Pauk als Eigenbehöriger nicht so
ohne weiteres über seinen Nachlaß und die Erbfolge
verfügen konnte, war ein längerer Schriftwechsel mit
dem Amt erforderlich.8 Doch
schließlich trat Margarete Ilsabein Tielke geb. Pauk
ihr elterliches Erbe an, so daß sie gemeinsam mit
ihrem Ehemann nun über zwei Stätten gleichzeitig
verfügte! Dabei war der Pauksche Hof in Unterwüsten
anscheinend attraktiver: Statt eines einzigen
Gebäudes wie bei Tielke gehörten nämlich ein
Wohnhaus, eine Leibzucht und ein Backhaus dazu. Auch
scheint das Land ertragreicher gewesen zu sein.9
Wohl aus diesen Gründen zog das Ehepaar Tielke um
1785 aus Oberwüsten dorthin um, wo ihnen schließlich
noch die Tochter Anna Sophia Friderica (1786), jetzt
unter dem Hofnamen Pauk, geboren wurde.
|
|
Nachdem der Ehemann Johann Töns Tielke, nun Pauk
genannt, am 1. Februar 1791 an der "Hauptkrankheit"
gestorben war, verwaltete die Witwe mit ihren
inzwischen nur noch fünf Kindern10 den Besitz
zunächst allein. Erst 1796 plante sie, eine zweite
Ehe mit dem Witwer Johann Hermann Pumpenmeier in
Unterwüsten Nr. 46 einzugehen. In diesem
Zusammenhang gehörte zweifellos der Entschluß zum
Freikauf. Denn durch die Heirat am 20. Oktober 1796
brachte die Witwe Tielke sogar eine dritte Stätte in
ihren, wenigstens zeitweiligen Besitz. Unklar ist,
ob sie zusammen mit ihren Kindern sofort zu ihrem
neuen Ehemann ziehen wollte und deshalb die
persönliche Freiheit für alle und die freie
Verfügbarkeit über ihre zuvor eigenbehörigen Stätten
benötigte. Jedenfalls ließen beide Eheleute am 5.
Juni 1801 ein neues Wohnhaus auf dem Hof Pumpenmeier
errichten.11 Hier, in der heutigen
Ringstraße 6a, ist Margarete Ilsabein auch am 15.
April 1823 im Alter von 73 Jahren an der
„Auszehrung“ gestorben. Ein anderes Motiv für den
umfassenden Freikauf könnte gewesen sein, über die
Erbfolge auf ihren anderen beiden Besitzungen frei
bestimmen zu können. Für den Paukschen Hof, der
ebenfalls am 30. Mai 1796 aus der Eigenbehörigkeit
entlassen wurde,12 muß auch eine entsprechende
Urkunde ausgefertigt worden sein, die die selbe
Person nicht als „Witwe Tielke“, sondern als „Witwe
Pauk“ genannt haben muß! So kam es jedenfalls, daß
von den beiden schließlich überlebenden Söhnen der
ältere die Stätte des Vaters erbte (Johann Henrich
Jürgen-Tielke, 1772-1847) und der jüngere die Stätte
der Mutter (Johann Bernd Pauk oder Buschmeier,
1778-1861). Der jüngste Sohn Philipp Henrich, vom
Pfarrer als hoffnungsvoller Jüngling (juvenis bonae
spei“) betrauert, starb 1796 im Alter von 15 Jahren
an einer in Wüsten grassierenden Ruhrepidemie. |
|
Die beiden Töchter heirateten später inerhalb der
Bauerschaft Unterwüsten auf die Höfe Franzmeier (Anna
Elisabeth, 1775-1814) und Wichmann Nr. 41 (Anna
Sophia Friderica, 1786-1866). – Das letzte genannte
jüngste der 1796 freigelassenen Kinder verstarb also
erst zu einer Zeit, als sich die Nachkommen der
einst „eigenbehörigen“ Lipper schon auf dem Weg ins
Kaiserreich befanden. |
|
|
Anmerkungen
|
1
Siehe den Bericht "Die Witwe und der Fürst", in
Lippische Landeszeitung vom 20.2.1997. Das dem Bad
Salzufler Stadtarchiv übergebene Dokument trägt
jetzt die Signatur S 10. - Für freundliche
Unterstützung danke ich Herrn Stadtarchivar Franz
Meier.
2 Erwin Schubert, Zeugen aus der
Vergangenheit Wüstens, Bad Salzuflen-Wüsten 1990, S.
68.
3 Vgl. Bernd Hüllinghorst, "Das keine
ärmere geplagte leute in der Grafschaft Lippe
wohneten!" Die lippische Leibherrschaft im 17.
Jahrhundert, in: Der Weserraum zwischen 1500 und
1650: Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur in der
frühen Neuzeit, Marburg 1993, S. 93-113. Zur
Einführung in die frühere lippische Agrarverfassung
vgl. immer noch Albrecht Tasche, Das lippische
Höferecht, Lage 1909; Heinrich August Krawinkel, die
Grundherrschaft in Lippe, in: Mitteilungen aus der
lippischen Geschichte und Landeskunde 15 (1935), S.
82-162.
4 Erich Kittel, Heimatchronik d. Kreises
Lippe, Köln 1978, S. 164. |
|
|
5 Bei
einem entsprechenden Freikauf des Hofes Feger Nr. 5 in Hardissen wurde bereits 1791 sogar von "künftiger"
allgemeiner "Aufhebung des Leibeigenthums"
gesprochen: vgl. Nicolas Rügge, Hardissen. Eine
lippische Ortsgeschichte, hrsg. vom Lippischen
Heimatbund, Ortsverein Lage, Lage 1997, S. 57.
6 Vgl. Dieter Potente, Ländliche
Gesellschaft im Zeitalter der Revolution, päd. Diss.
Münster 1987, S. 212 ff.
7 Hauptquelle für die folgenden Angaben
sind die auf Mikrofiches verfilmten Wüstener
Kirchenbücher sowie die Eheprotokolle (L 108 A) im
Staatsarchiv Detmold (STAD).
8 STAD, L 83 A, Nr. 12 P 110.
9 Vgl. das Salbuch (Vorläufer des
heutigen Katasters) von 1782: STAD, L 101 C 1, Amt
Schötmar Nr. 15, S. 1454f (Pauk) und S 1676f. (Tielke).
10 Der 1783 geborene Sohn Johann
Friedrich war am 8. Mai 1784 gestorben.
11 Sie wird in der Inschrift als "Anna
Margarethe Ilsabein Berndt Pauks" bezeichnet; vgl.
Schubert (wie Anm. 2), S. 46.
12 STAD, L 101 C 1, Amt Schötmar Nr. 15
S. 1454f. |
|
|
|
| |